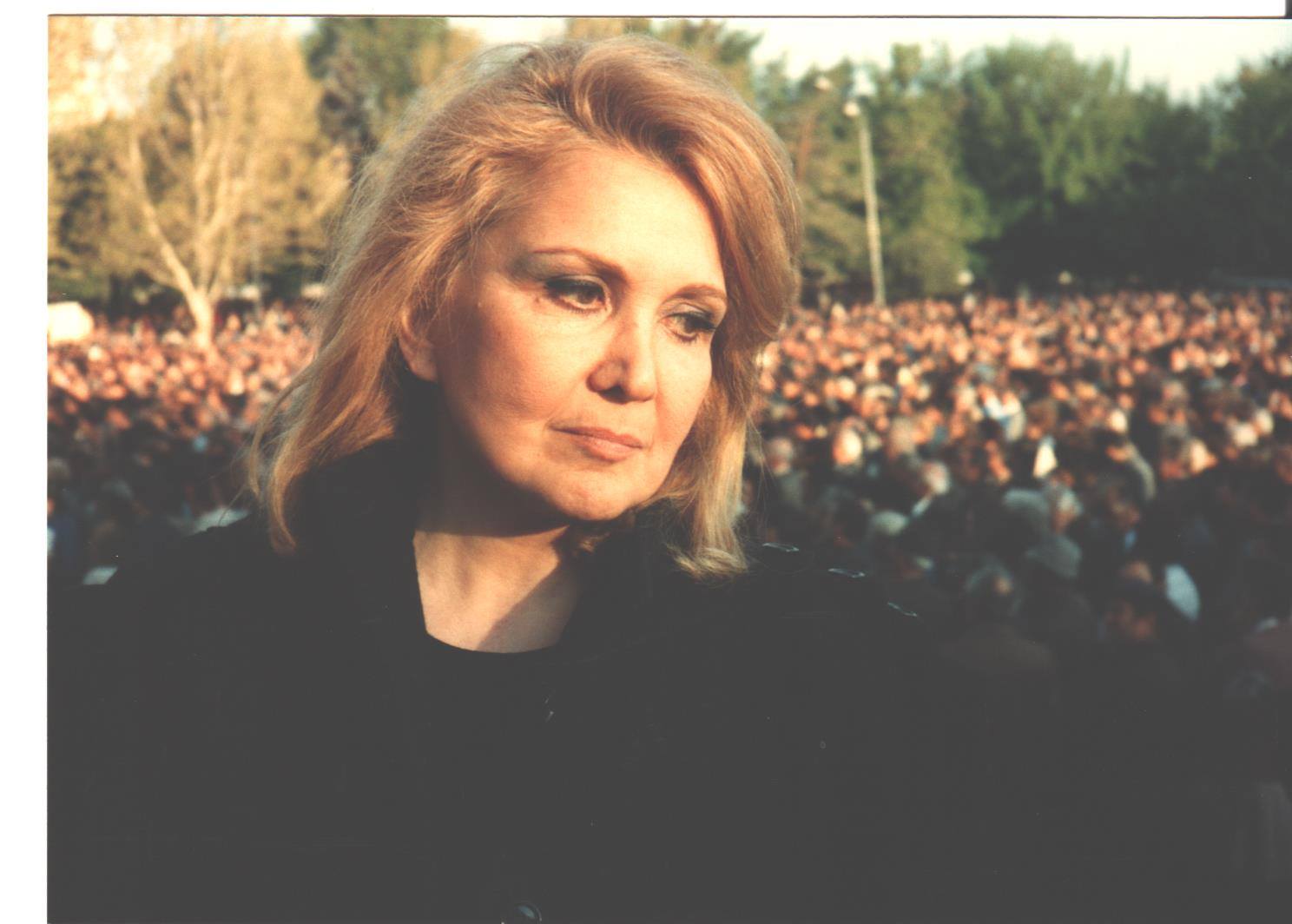Zwischen Duduk und Blue Notes
Armenischer Jazz als Klang der Erinnerung


Wie eine verbotene Musik zum Echo einer Nation wurde – und am 18. Oktober in Stuttgart erklingt
Stellen Sie sich eine kleine Taverne in Jerewan vor, irgendwann in den 1960er Jahren. Der Rauch hängt schwer in der Luft, dichter als die Gespräche, die sich durch den Raum weben. In einer Ecke singt eine Duduk – jenes uralte armenische Holzblasinstrument – eine melancholische Melodie, die nach Heimat klingt und zugleich nach Verlust. Und daneben, fast wie ein Widerspruch, improvisiert ein Pianist über eine harmonische Wendung, die ebenso gut in einem Club in New Orleans gespielt werden könnte.
Ein paar Jahre zuvor wäre dieser Klang noch verboten gewesen. Jazz galt in der Sowjetunion als „dekadent“, als Musik des kapitalistischen Feindes, als gefährlich. Doch in Armenien ließ er sich nicht verbieten. Er fand Wege, so wie Wasser durch Ritzen sickert, so wie Hoffnung durch die dunkelsten Zeiten dringt.
Mehr als Musik: Das Echo einer Nation
Armenischer Jazz ist keine Fußnote der Musikgeschichte. Er ist das Echo einer Nation, die stets zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Moderne stand – und die gelernt hat, aus dieser Spannung Schönheit zu schaffen. Jazz, selbst eine Musik der Verfolgten und Entrechteten, fand hier ein Resonanzfeld, das tiefer nicht sein könnte.
Die Geschichte beginnt früher, als man denken würde. Schon 1936 gründete Tsolak Vardazaryan in Jerewan die erste Jazzband. Zwei Jahre später folgte das Armenian State Jazz Orchestra – das erste seiner Art in der gesamten Sowjetunion. Während Stalin den Jazz zeitweise verbot und ihn als „Waffe des Klassenfeinds“ brandmarkte, spielte das Orchester dennoch weiter, für die Rote Armee, in versteckten Sälen, überall dort, wo Musik noch möglich war.
Unter Chruschtschow kam die Renaissance. Plötzlich war Jazz nicht mehr verboten, sondern toleriert, manchmal sogar gefördert. In Armenien explodierte die Szene. Artemi Ayvazyan, der in den 1930er Jahren eines der ersten Jazzorchester der Sowjetunion gegründet hatte, wurde zur Legende. Konstantin Orbelyan, Dirigent und Komponist, gab dem armenischen Jazz eine sinfonische Tiefe. Und dann war da Levon „Malkhas“ Malkhasyan, dessen Trio Generationen prägte und der 1980 den ersten Jazzclub in Jerewan gründete – ein Ort, der bis heute Pilger aus der ganzen Welt anzieht.
Wurzeln im Widerstand
Dass Jazz in Armenien so tiefe Wurzeln schlug, hat auch mit dem Trauma der Geschichte zu tun. Der Völkermord von 1915 hinterließ ein zerrissenes Volk, verstreut über alle Kontinente. Armenier lebten in Istanbul, Paris, Beirut, New York, Los Angeles – überall, nur nicht immer in Armenien. Musik wurde zum unsichtbaren Band, das die Gemeinschaft zusammenhielt. Und Jazz, diese Musik des Exils und der Improvisation, fand hier einen Boden, auf dem er wachsen konnte.
Es ist kein Zufall, dass viele armenische Jazzmusiker die Themen Heimweh, Verlust und Hoffnung in ihre Kompositionen einweben. Jazz erlaubte ihnen, über das Unaussprechliche zu sprechen – nicht mit Worten, sondern mit Klängen, die direkter zur Seele reichen als jede Sprache.
Instrumente der Sehnsucht
Das Besondere am armenischen Jazz ist die Fusion – aber nicht im oberflächlichen Sinne des Wortes. Es geht nicht darum, exotische Klänge aufzusetzen wie eine Maske. Es geht um eine organische Verschmelzung, bei der zwei Welten wirklich eins werden.
Neben Klavier, Saxophon und Kontrabass erklingen Duduk, Shvi oder Blul – Instrumente, deren Klang von Jahrhunderten der Folklore durchdrungen ist. Die Duduk, aus Aprikosenholz geschnitzt, hat einen Ton, der zugleich warm und melancholisch ist, als würde die Erde selbst seufzen. Wenn sie neben einem Jazz-Piano erklingt, entsteht etwas Magisches: eine Musik, die zugleich improvisiert und verwurzelt ist, rhythmisch geprägt vom Kaukasus, melodisch getragen von armenischen Volksliedern, und doch offen für die Freiheit des Jazz.
„Es ist, als würde man Komitas mit Thelonious Monk zusammensetzen“, sagte einmal ein Kritiker – und traf damit den Kern. Komitas Vardapet, der große armenische Komponist und Sammler von Volksliedern, und Monk, der exzentrische Meister des modernen Jazz: zwei Welten, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Und doch sprechen sie dieselbe Sprache – die Sprache der Sehnsucht, der Komplexität, der unerwarteten Wendungen.
Stimmen einer Szene
Die Liste der armenischen Jazzmusiker liest sich wie ein Panorama aus Leidenschaft und Erneuerung:
Levon Malkhasyan (1945–2022), der „Vater des armenischen Jazz“, war nicht nur ein virtuoser Pianist, sondern auch ein Brückenbauer. Sein Trio spielte in einer Zeit, als die Sowjetunion noch existierte, und doch klang ihre Musik nach Freiheit. Sein Jazzclub in Jerewan wurde zur Institution, ein Ort, an dem Generationen von Musikern ihre ersten Sessions spielten.
Arto Tunçboyacıyan, Perkussionist und Komponist, brachte mit der Armenian Navy Band World-Jazz-Fusion auf die internationale Bühne. Seine Rhythmen sind unverkennbar – eine Mischung aus kaukasischen Tänzen, orientalischen Grooves und der pulsierenden Energie des Jazz.
Vahagn Hayrapetyan, Pianist und Pädagoge, widmete sein Leben der Aufgabe, armenische Volkslieder in Jazz-Standards zu verwandeln. Er war Lehrer von Tigran Hamasyan, und sein Einfluss ist in jeder Note zu spüren, die Hamasyan heute spielt.
Armen Hyusnunts, Saxophonist und Leiter des State Jazz Orchestra, führt die Tradition fort und widmet sich den Werken armenischer Komponisten wie Arno Babajanyan, der selbst ein Meister darin war, Klassik und Jazz miteinander zu verweben.
Und natürlich Tigran Hamasyan selbst – der Pianist, der mit seinen Alben von A Fable bis The Bird of a Thousand Voices eine unverwechselbare Verbindung von Jazz, Metal, armenischer Spiritualität und experimenteller Musik geschaffen hat. Hamasyan ist vielleicht der bekannteste armenische Jazzmusiker unserer Zeit, aber er steht nicht allein. Er steht auf den Schultern von Generationen, die vor ihm kamen.
Diese Musiker beweisen: Armenischer Jazz ist keine Kopie, kein „Jazz mit armenischem Beigeschmack“. Er ist eine originäre Sprache, ein eigenständiger Dialekt im großen Gespräch des Jazz.
Von Jerewan nach Stuttgart
Dass dieser Klang nun in Stuttgart erklingt, ist ein Geschenk – und eine Brücke. Am 18. Oktober 2025 gastiert im Rahmen der Armenischen Kulturtage Stuttgart das Tigran Tatevosyan Trio im Kleinen Kursaal.
Der Pianist Tigran Tatevosyan, nominiert für den Deutschen Jazzpreis 2025 als „Newcomer des Jahres“, ist ein Künstler, der genau weiß, woher er kommt und wohin er will. Sein Debütalbum trägt den programmatischen Titel Mer Tan Itev – „Auf dem Weg nach Hause“. Es ist eine musikalische Reise, die armenische Tradition mit modernem Jazz verbindet, ohne je nostalgisch oder verklärt zu wirken.
Gemeinsam mit Amir Bresler am Schlagzeug und Omar Rodriguez Calvo am Bass entfaltet Tatevosyan einen Sound, der von den Bergen Armeniens ebenso erzählt wie von den Jazzclubs in Tel Aviv, Berlin oder New York. Seine Melodien erinnern an Volkslieder, die man zu kennen glaubt, auch wenn man sie nie zuvor gehört hat. Seine Improvisationen sind frei und doch strukturiert, wie ein Gespräch, das immer neue Wendungen nimmt, ohne je den Faden zu verlieren.
Mehr als ein Konzert
Armenischer Jazz ist auch ein soziales Ritual. Er bringt Menschen zusammen – in Clubs, auf Festivals, in improvisierten Sessions. In Jerewan ist das International Jazz Festival seit 1998 ein Fixpunkt im kulturellen Kalender. Diaspora-Gemeinden in Beirut, Paris oder Los Angeles organisieren eigene Konzerte, bei denen Jazz zum verbindenden Element wird, zum Gesprächsstoff zwischen Generationen.
Und seit einigen Jahren gehört auch Stuttgart zu den Orten, an denen armenischer Jazz eine Bühne findet. Das ist nicht selbstverständlich – und umso wertvoller.
Am Konzertabend dürfen sich die Gäste nicht nur auf Musik freuen, sondern auch auf ein Stück armenische Lebensart: In der Pause werden Weine aus Armenien verkostet – reich an Sonne, voller Geschichte, so wie der Jazz selbst. Es ist eine Einladung, nicht nur mit den Ohren, sondern mit allen Sinnen einzutauchen in eine Kultur, die älter ist als die meisten europäischen Nationen und doch so lebendig wie eine Improvisation.
Ein Klang der Resilienz
Armenischer Jazz ist ein Klang der Resilienz. Er überlebte Verbote, politische Brüche, Kriege. Er überlebte die Sowjetunion, die Umbrüche der 1990er Jahre, die Konflikte der Gegenwart. Heute steht er für Freiheit, Kreativität und die Fähigkeit, Brücken zu schlagen – zwischen Tradition und Moderne, zwischen Ost und West, zwischen Erinnerung und Zukunft.
Am 18. Oktober öffnet sich in Stuttgart ein Fenster in diese Welt. Das Tigran Tatevosyan Trio lädt ein zu einer Reise zwischen Duduk und Blue Notes, zwischen Ararat und Harlem, zwischen dem, was war, und dem, was noch kommen wird.
Lassen Sie sich treiben, lassen Sie sich verzaubern. Jazz war immer schon mehr als Musik – er ist ein Gespräch. Und dieser Abend verspricht, ein Gespräch zwischen Armenien und der Welt zu werden, eines, das lange nachhallt, auch wenn der letzte Ton längst verklungen ist.
Jazz-Konzert: Tigran Tatevosyan Trio – „Mer Tan Itev“
18. Oktober 2025, 20:00 Uhr
Kleiner Kursaal, Königsplatz 1, 70372 Stuttgart
Mehr Informationen über Tigran Tatevosyan hier.
AGBW Team
für die Armenischen Kulturtage Stuttgart